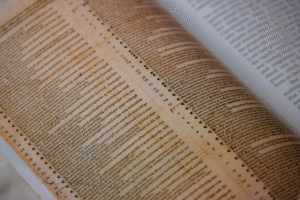Luthers 95 Thesen
Die 95 Thesen des Martin Luthers sind 95 Forderungen, welche der Theologe im Jahr 1517 aufstellte. Laut einer Legende soll Martin Luther die Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg angeschlagen haben. Der Thesenanschlag fand am 31. Oktober 1517 statt. Dieser Tag wird heute als Reformationstag in einigen Bundesländern gefeiert.
Luthers Thesen sollten bewirken, die römisch-katholische Kirche umzugestalten bzw. reformieren. Die Thesen waren demnach eine Kirchenkritik, welche zur Kirchenreform aufrufen sollten.
Im Zentrum der Kirchenkritik stand der sogenannte Ablasshandel. Dem Sünder wurde durch den Handel mit Ablassbriefen suggeriert, dass er sich einer Strafe entziehen könne. Mit dem Kauf eines Ablassbriefes konnte man sich Gottesgnade und somit das Seelenheil sowie das ewige Leben erkaufen.
Doch laut Martin Luther kann nur Gott allein gnädig sein. Man kann Gottesgnade nicht erkaufen und kein Priester hätte überhaupt ein Mitspracherecht. Somit vertrat Luther die Ansicht, dass sich die Kirche durch den Verkauf von Ablassbriefen unrechtmäßig bereichern würde.
Umstritten ist der Thesenanschlag von Wittenberg. Laut dieser Erzählung soll Luther die 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt haben. Dieses Datum gilt als Reformationstag, dem Beginn der Reformation innerhalb der Westkirche. In der Folge dieser Ereignisse spaltete sich die Westkirche in zwei Konfessionen auf. Daraus entstanden die katholische und die evangelische Kirche.
Inhalt
- 1 Steckbrief
- 2 Was sind die 95 Thesen
- 3 Was stand in den 95 Thesen
- 4 Wie lauten die 95 im Einzelnen
- 5 Warum schrieb Martin Luther die 95 Thesen
- 6 Wo hat Martin Luther die 95 Thesen angeschlagen
- 7 Wie wurden die 95 tatsächlich veröffentlicht
- 8 In welcher Sprache waren die 95 Thesen ursprünglich verfasst
- 9 Was wollte Luther mit den 95 Thesen erreichen
- 10 Wie reagierten Papst und Kirche auf die 95 Thesen
- 11 Welche Folgen hatte die Veröffentlichung der 95 Thesen
Steckbrief
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Bedeutung: | Kirchenkritik |
| Ursprünglicher Titel: | Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe) |
| Herausgeber: | Martin Luther |
| Veröffentlichung: | 31. Oktober 1517 |
| Ursachen: | Luther wollte Diskussion über den Ablasshandel anstoßen |
| Folgen: | 1518: Luther wird als Ketzer angeklagt 1521: Reichsbann über Luther Reformation der Westkirche und anschließende Kirchenspaltung |
Was sind die 95 Thesen
Die 95 Thesen sind eine Liste mit Vorschlägen, welche 1517 von Martin Luther verfasst und veröffentlicht wurden. Zentrales Anliegen dieser Thesen war der Ablasshandel, welchen die Kirche betrieb und förderte.
Mit sogenannten Ablassbriefen konnten sich Sünder von ihren Sünden freikaufen und somit die Gnade Gottes erfahren. Durch diese Gottesgnade wurde ihnen das Seelenheil zuteil und sie bekamen ein Anrecht auf ewiges Leben im Gottesreich (Himmelreich).
Laut Luther war die Gottesgnade aber nichts, was man sich verdienen oder mit einer Geldsumme einkaufen musste. Und genau in dieser Glaubensvorstellung unterschieden sich Lutheraner und Katholiken.
So glaubten Katholiken, dass man sich den Platz im Gottesreich irgendwie verdienen müsse. Und Luther behauptete, dass allein die Gottesgnade darüber entscheidet – wer im Reich Gottes landet und wer nicht. Denn allein Gott sei der Richter beim Jüngsten Gericht.
Da laut Luther die Priester keinen Einfluss auf die Gottesgnade hatten, warf er der Westkirche vor – sich am Geld der Gläubigen zu bereichern. In der Folge wurde Luther aus der Kirche ausgeschlossen und seine Schriften wurden verboten.
Da Luther aber die Sprache der einfachen Bevölkerung sprach und in dieser schrieb, hatte er enormen Zulauf. In der Folge kam es zu einer Kirchenspaltung, wonach sich die Westkirche in ein protestantisch-lutherisches und ein römisch-katholisches Lager spaltete.
Rückblickend wird davon ausgegangen, dass die Veröffentlichung der 95 Thesen jene Reformation und Spaltung der Westkirche einleitete. Demnach sind die 95 Thesen der Auslöser der lutherisch-protestantischen Reformation. Allerdings gab es bereits vor Luthers Thesen schon mehrere Versuche, eine Reformation der katholischen Kirche durchzuführen. Diese Versuche scheiterten, werden aber als Proto-Protestantismus zusammengefasst.
Was stand in den 95 Thesen
Der Ablasshandel funktionierte nur so gut, weil alle Gläubigen an etwas glaubten. Und zwar glaubten sie daran, für ihre Sünden im Fegefeuer zu landen.
Deshalb betrieb die Kirche eine regelrechte Propaganda ums Fegefeuer und schürte zusätzlich Angst, um ihren Handel mit Ablassbriefen voranzutreiben. Demnach richten sich Luthers erste Thesen genau gegen diese Angstmacherei.
Ab These 21 geht es ganz speziell um den Ablasshandel. Die Kritik am Handel mit Ablassbriefen zieht sich bis zur 93. These durch.
Luther bezeichnet den Handel mit Ablassbriefen als durchaus lukratives Geschäft, spricht ihm aber seine Funktionalität ab. Denn, wie bereits im letzten Abschnitt beschrieben, muss die Gottesgnade nicht verdient oder erkauft werden.
In einigen Thesen tauchen zudem Fragen auf, welche zum Nachdenken oder zum Aufbegehren anregen sollen. So etwa in der These 86, wo Luther die Frage formuliert – weshalb der Papst seine Bauwerke nicht selbst finanziert, anstelle das Geld von den armen Gläubigen zu nehmen.
Wie lauten die 95 im Einzelnen
| Nummer | Inhalt |
|---|---|
| 1. | Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. |
| 2. | Dieses Wort darf nicht auf die sakramentale Buße gedeutet werden, das heißt, auf jene Buße mit Beichte und Genugtuung, die unter Amt und Dienst der Priester vollzogen wird. |
| 3. | Gleichwohl zielt dieses Wort nicht nur auf eine innere Buße; ja, eine innere Buße ist keine, wenn sie nicht äußerlich vielfältige Marter des Fleisches schafft. |
| 4. | Daher bleibt Pein, solange Selbstverachtung, das ist wahre innere Buße, bleibt, nämlich bis zum Eintritt in das Himmelreich. |
| 5. | Der Papst will und kann nicht irgendwelche Strafen erlassen, außer denen, die er nach dem eigenen oder nach dem Urteil von Kirchenrechtssätzen auferlegt hat. |
| 6. | Der Papst kann nicht irgendeine Schuld erlassen; er kann nur erklären und bestätigen, sie sei von Gott erlassen. Und gewiss kann er ihm selbst vorbehaltene Fälle erlassen; sollte man diese verachten, würde eine Schuld geradezu bestehen bleiben. |
| 7. | Überhaupt niemandem vergibt Gott die Schuld, ohne dass er ihn nicht zugleich – in allem erniedrigt – dem Priester, seinem Vertreter, unterwirft. |
| 8. | Die kirchenrechtlichen Bußsatzungen sind allein den Lebenden auferlegt; nach denselben darf Sterbenden nichts auferlegt werden. |
| 9. | Daher erweist uns der Heilige Geist eine Wohltat durch den Papst, indem dieser in seinen Dekreten Tod- und Notsituationen immer ausnimmt. |
| 10. | Dumm und übel handeln diejenigen Priester, die Sterbenden kirchenrechtliche Bußstrafen für das Fegfeuer vorbehalten. |
| 11. | Jenes Unkraut von kirchlicher Bußstrafe, die in Fegfeuerstrafe umgewandelt werden muss, ist offenbar gerade, als die Bischöfe schliefen, ausgesät worden. |
| 12. | Einst wurden kirchliche Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Lossprechung auferlegt, gleichsam als Proben echter Reue. |
| 13. | Sterbende lösen mit dem Tod alles ein; indem sie den Gesetzen des Kirchenrechts gestorben sind, sind sie schon deren Rechtsanspruch enthoben. |
| 14. | Die unvollkommene geistliche Gesundheit oder Liebe des Sterbenden bringt notwendig große Furcht mit sich; diese ist umso größer, je geringer jene ist. |
| 15. | Diese Furcht und dieses Erschrecken sind für sich allein hinreichend – ich will von anderem schweigen –, um Fegfeuerpein zu verursachen, da sie dem Schrecken der Verzweiflung äußerst nahe sind. |
| 16. | Hölle, Fegfeuer, Himmel scheinen sich so zu unterscheiden wie Verzweiflung, Fast-Verzweiflung, Gewissheit. |
| 17. | Es scheint notwendig, dass es für Seelen im Fegfeuer ebenso ein Abnehmen des Schreckens wie auch ein Zunehmen der Liebe gibt. |
| 18. | Und es scheint weder durch Gründe der Vernunft noch der Heiligen Schrift erwiesen zu sein, dass Seelen im Fegfeuer außerhalb eines Status von Verdienst oder Liebeswachstum sind. |
| 19. | Und auch dies scheint nicht erwiesen zu sein, dass sie wenigstens alle ihrer Seligkeit sicher und gewiss sind, mögen schon wir davon völlig überzeugt sein. |
| 20. | Deshalb meint der Papst mit „vollkommener Erlass aller Strafen“ nicht einfach „aller“, sondern nur derjenigen, die er selbst auferlegt hat. |
| 21. | Es irren daher diejenigen Ablassprediger, die da sagen, dass ein Mensch durch Ablässe des Papstes von jeder Strafe gelöst und errettet wird. |
| 22. | Ja, der Papst erlässt den Seelen im Fegfeuer keine einzige Strafe, die sie nach den kirchenrechtlichen Bestimmungen in diesem Leben hätten abtragen müssen. |
| 23. | Wenn überhaupt irgendein Erlass aller Strafen jemandem gewährt werden kann, dann ist gewiss, dass er nur den Vollkommensten, d. h. den Allerwenigsten gewährt werden kann. |
| 24. | Unausweichlich wird deshalb der größte Teil des Volkes betrogen durch jene unterschiedslose und großspurige Zusage erlassener Strafe. |
| 25. | Die Vollmacht, die der Papst über das Fegfeuer im allgemeinen hat, hat jeder Bischof und jeder Pfarrer in seiner Diözese und in seiner Pfarrei im besonderen. |
| 26. | Der Papst tut sehr wohl daran, dass er den Seelen nicht nach der Schlüsselgewalt, die er so gar nicht hat, sondern in Gestalt der Fürbitte Erlass gewährt. |
| 27. | Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in den Kasten fällt. |
| 28. | Das ist gewiss: Fällt die Münze klingelnd in den Kasten, können Gewinn und Habgier zunehmen. Die Fürbitte der Kirche aber liegt allein in Gottes Ermessen. |
| 29. | Wer weiß denn, ob alle Seelen im Fegfeuer losgekauft werden wollen, wie es nach der Erzählung bei den Heiligen Severin und Paschalis passiert sein soll. |
| 30. | Keiner hat Gewissheit über die Wahrhaftigkeit seiner Reue, noch viel weniger über das Gewinnen vollkommenen Straferlasses. |
| 31. | So selten einer wahrhaftig Buße tut, so selten erwirbt einer wahrhaftig Ablässe, das heißt: äußerst selten. |
| 32. | In Ewigkeit werden mit ihren Lehrern jene verdammt werden, die glauben, sich durch Ablassbriefe ihres Heils versichert zu haben. |
| 33. | Ganz besonders in Acht nehmen muss man sich vor denen, die sagen, jene Ablässe des Papstes seien jenes unschätzbare Geschenk Gottes, durch das der Mensch mit Gott versöhnt werde. |
| 34. | Denn jene Ablassgnaden betreffen nur die Strafen der sakramentalen Satisfaktion, die von Menschen festgesetzt worden sind. |
| 35. | Unchristliches predigen diejenigen, die lehren, dass bei denen, die Seelen loskaufen oder Beichtbriefe erwerben wollen, keine Reue erforderlich sei. |
| 36. | Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld; der ihm auch ohne Ablassbriefe zukommt. |
| 37. | Jeder wahre Christ, lebend oder tot, hat, ihm von Gott geschenkt, teil an allen Gütern Christi und der Kirche, auch ohne Ablassbriefe. |
| 38. | Was aber der Papst erlässt und woran er Anteil gibt, ist keineswegs zu verachten, weil es – wie ich schon sagte – die Kundgabe der göttlichen Vergebung ist. |
| 39. | Selbst für die gelehrtesten Theologen ist es ausgesprochen schwierig, vor dem Volk den Reichtum der Ablässe und zugleich die Wahrhaftigkeit der Reue herauszustreichen. |
| 40. | Wahre Reue sucht und liebt die Strafen; der Reichtum der Ablässe aber befreit von ihnen und führt dazu, die Strafen – zumindest bei Gelegenheit – zu hassen. |
| 41. | Mit Vorsicht sind die (päpstlich-)apostolischen Ablässe zu predigen, damit das Volk nicht fälschlich meint, sie seien den übrigen guten Werken der Liebe vorziehen. |
| 42. | Man muss die Christen lehren: Der Papst hat nicht im Sinn, dass der Ablasskauf in irgendeiner Weise den Werken der Barmherzigkeit gleichgestellt werden solle. |
| 43. | Man muss die Christen lehren: Wer einem Armen gibt oder einem Bedürftigen leiht, handelt besser, als wenn er Ablässe kaufte. |
| 44. | Denn durch ein Werk der Liebe wächst die Liebe, und der Mensch wird besser. Aber durch Ablässe wird er nicht besser, sondern nur freier von der Strafe. |
| 45. | Man muss die Christen lehren: Wer einen Bedürftigen sieht, sich nicht um ihn kümmert und für Ablässe etwas gibt, der erwirbt sich nicht Ablässe des Papstes, sondern Gottes Verachtung. |
| 46. | Man muss die Christen lehren: Wenn sie nicht im Überfluss schwimmen, sind sie verpflichtet, das für ihre Haushaltung Notwendige aufzubewahren und keinesfalls für Ablässe zu vergeuden. |
| 47. | Man muss die Christen lehren: Ablasskauf steht frei, ist nicht geboten. |
| 48. | Man muss die Christen lehren: Wie der Papst es stärker braucht, so wünscht er sich beim Gewähren von Ablässen lieber für sich ein frommes Gebet als bereitwillig gezahltes Geld. |
| 49. | Man muss die Christen lehren: Die Ablässe des Papstes sind nützlich, wenn die Christen nicht auf sie vertrauen, aber ganz und gar schädlich, wenn sie dadurch die Gottesfurcht verlieren. |
| 50. | Man muss die Christen lehren: Wenn der Papst das Geldeintreiben der Ablassprediger kennte, wäre es ihm lieber, dass die Basilika des Heiligen Petrus in Schutt und Asche sinkt als dass sie erbaut wird aus Haut, Fleisch und Knochen seiner Schafe. |
| 51. | Man muss die Christen lehren: Der Papst wäre, wie er es schuldig ist, bereit, sogar durch den Verkauf der Basilika des Heiligen Petrus, wenn es sein müsste, von seinem Geld denen zu geben, deren Masse gewisse Ablassprediger das Geld entlocken. |
| 52. | Nichtig ist die Heilszuversicht durch Ablassbriefe, selbst wenn der Ablasskommissar, ja, sogar der Papst selbst, seine Seele für sie verpfändete. |
| 53. | Feinde Christi und des Papstes sind diejenigen, die anordnen, wegen der Ablasspredigten habe das Wort Gottes in den anderen Kirchen völlig zu schweigen. |
| 54. | Unrecht geschieht dem Wort Gottes, wenn in ein und derselben Predigt den Ablässen gleichviel oder längere Zeit gewidmet wird wie ihm selbst. |
| 55. | Meinung des Papstes ist unbedingt: Wenn Ablässe, was das Geringste ist, mit einer Glocke, einer Prozession und einem Gottesdienst gefeiert werden, dann muss das Evangelium, das das Höchste ist, mit hundert Glocken, hundert Prozessionen, hundert Gottesdiensten gepredigt werden. |
| 56. | Die Schätze der Kirche, aus denen der Papst die Ablässe austeilt, sind weder genau genug bezeichnet noch beim Volk Christi erkannt worden. |
| 57. | Zeitliche Schätze sind es offenkundig nicht, weil viele der Prediger sie nicht so leicht austeilen, sondern nur einsammeln. |
| 58. | Es sind auch nicht die Verdienste Christi und der Heiligen; denn sie wirken ohne Papst immer Gnade für den inneren Menschen, aber Kreuz, Tod und Hölle für den äußeren. |
| 59. | Der heilige Laurentius sagte, die Schätze der Kirche seien die Armen der Kirche. Aber er redete nach dem Wortgebrauch seiner Zeit. |
| 60. | Wohlüberlegt sagen wir: Die Schlüsselgewalt der Kirche, durch Christi Verdienst geschenkt, ist dieser Schatz. |
| 61. | Denn es ist klar, dass für den Erlass von Strafen und von ihm vorbehaltenen Fällen allein die Vollmacht des Papstes genügt. |
| 62. | Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. |
| 63. | Er ist aber aus gutem Grund ganz verhasst, denn er macht aus Ersten Letzte. |
| 64. | Der Schatz der Ablässe ist hingegen aus gutem Grund hochwillkommen, denn er macht aus Letzten Erste. |
| 65. | Also sind die Schätze des Evangeliums die Netze, mit denen man einst Menschen von Reichtümern fischte. |
| 66. | Die Schätze der Ablässe sind die Netze, mit denen man heutzutage die Reichtümer von Menschen abfischt. |
| 67. | Die Ablässe, die die Prediger als „allergrößte Gnaden“ ausschreien, sind im Hinblick auf die Gewinnsteigerung tatsächlich als solche zu verstehen. |
| 68. | Doch in Wahrheit sind sie die allerkleinsten, gemessen an der Gnade Gottes und seiner Barmherzigkeit im Kreuz. |
| 69. | Bischöfe und Pfarrer sind verpflichtet, die Kommissare der apostolischen Ablässe mit aller Ehrerbietung walten zu lassen. |
| 70. | Aber noch stärker sind sie verpflichtet, mit scharfen Augen und offenen Ohren darauf zu achten, dass die Kommissare nicht anstelle des Auftrags des Papstes ihre eigenen Einfälle predigen. |
| 71. | Wer gegen die Wahrheit der apostolischen Ablässe redet, der soll gebannt und verflucht sein. |
| 72. | Wer aber seine Aufmerksamkeit auf die Willkür und Frechheit in den Worten eines Ablasspredigers richtet, der soll gesegnet sein. |
| 73. | Wie der Papst mit Recht den Bann gegen die schmettert, die mit einigem Geschick etwas zum Schaden des Ablasshandels im Schilde führen, |
| 74. | so viel mehr beabsichtigt er, den Bann gegen die zu schmettern, die unter dem Deckmantel der Ablässe etwas zum Schaden der heiligen Liebe und Wahrheit im Schilde führen. |
| 75. | Zu glauben, die päpstlichen Ablässe seien derart, dass sie einen Menschen absolvieren könnten, selbst wenn er – gesetzt den unmöglichen Fall – die Gottesgebärerin vergewaltigt hätte, das ist verrückt sein. |
| 76. | Wir sagen dagegen: Die päpstlichen Ablässe können nicht einmal die kleinste der lässlichen Sünden tilgen, was die Schuld betrifft. |
| 77. | Dass gesagt wird, selbst wenn der heilige Petrus jetzt Papst wäre, könnte er nicht größere Gnaden gewähren - das ist Blasphemie gegen den heiligen Petrus und den Papst. |
| 78. | Wir sagen dagegen: Auch dieser [Petrus] und jeder Papst haben noch größere Gnaden, nämlich das Evangelium, Wunderkräfte, Gaben, gesund zu machen, wie 1 Kor 12,28. |
| 79. | Zu sagen, das mit dem päpstlichen Wappen ins Auge fallend aufgerichtete Kreuz habe den gleichen Wert wie das Kreuz Christi, ist Blasphemie. |
| 80. | Rechenschaft werden die Bischöfe, Pfarrer und Theologen zu geben haben, die zulassen, dass solche Predigten vor dem Volk feilgeboten werden. |
| 81. | Diese unverfrorene Ablassverkündigung führt dazu, dass es selbst für gelehrte Männer nicht leicht ist, die Achtung gegenüber dem Papst wiederherzustellen angesichts der Anschuldigungen oder der gewiss scharfsinnigen Fragen der Laien. |
| 82. | Zum Beispiel: Warum räumt der Papst das Fegfeuer nicht aus um der heiligsten Liebe willen und wegen der höchsten Not der Seelen als dem berechtigtsten Grund von allen, wenn er doch unzählige Seelen loskauft wegen des unseligen Geldes zum Bau der Basilika als dem läppischsten Grund. |
| 83. | Wiederum: Warum bleibt es bei den Messen und Jahrgedächtnissen für die Verstorbenen, und warum gibt er die dafür eingerichteten Stiftungen nicht zurück oder erlaubt deren Rücknahme, wo es doch schon Unrecht ist, für [vom Fegfeuer] Erlöste zu beten? |
| 84. | Wiederum: Was ist das für eine neue Barmherzigkeit Gottes und des Papstes, dass sie einem Gottlosen und einem Feindseligen um Geldes willen zugestehen, eine fromme und Gott befreundete Seele loszukaufen? Gleichwohl befreien sie diese fromme und geliebte Seele nicht aus uneigennütziger Liebe um deren eigener Not willen. |
| 85. | Wiederum: Warum werden die kirchlichen Bußsatzungen, die der Sache nach und durch Nicht-Anwendung schon lange in sich selbst ausser Kraft gesetzt und tot sind, gleichwohl noch immer durch Bewilligung von Ablässen mit Geldern gerettet, als steckten sie voller Leben? |
| 86. | Wiederum: Warum baut der Papst, dessen Reichtümer heute weit gewaltiger sind als die der mächtigsten Reichen, nicht wenigstens die eine Basilika des Heiligen Petrus mehr von seinen eigenen Geldern als von denen der armen Gläubigen? |
| 87. | Wiederum: Was gibt der Papst denen als Erlass oder Anteil, die durch vollkommene Reue ein Recht auf vollen Erlass und vollen Anteil haben? |
| 88. | Wiederum: Was könnte der Kirche einen größeren Vorteil verschaffen werden, wenn der Papst, wie er es einmal tut, hundertmal am Tag jedem Gläubigen diese Erlässe und Anteile gewährte? |
| 89. | Vorausgesetzt, der Papst sucht durch die Ablässe mehr das Heil der Seelen als die Gelder - warum setzt er dann schon früher gewährte Schreiben und Ablässe außer Kraft, obgleich sie doch ebenso wirksam sind? |
| 90. | Diese scharfen, heiklen Argumente der Laien allein mit Gewalt zu unterdrücken und nicht durch Gegengründe zu entkräften, heißt, die Kirche und den Papst den Feinden zum Gespött auszusetzen und die Christen unglücklich zu machen. |
| 91. | Wenn also die Ablässe nach dem Geist und im Sinne des Papstes gepredigt würden, wären alle jene Einwände leicht aufzulösen, ja, es gäbe sie gar nicht. |
| 92. | Mögen daher all jene Propheten verschwinden, die zum Volk Christi sagen: Friede, Friede!, und ist doch nicht Friede. |
| 93. | Möge es all den Propheten wohlergehen, die zum Volk Christi sagen: Kreuz, Kreuz!, und ist doch nicht Kreuz. |
| 94. | Man muss die Christen ermutigen, darauf bedacht zu sein, dass sie ihrem Haupt Christus durch Leiden, Tod und Hölle nachfolgen. |
| 95. | Und so dürfen sie darauf vertrauen, eher durch viele Trübsale hindurch in den Himmel einzugehen als durch die Sicherheit eines Friedens. |
Warum schrieb Martin Luther die 95 Thesen
Luther wollte eigentlich mit den 95 Thesen eine Diskussion unter Theologen anstoßen, um die Sinnhaftigkeit des Ablasshandels prüfen zu lassen. Seine Beweggründe waren wohlmöglich vielschichtig. So könnte die Moralphilosophie Luthers und die daraus abgeleitete Rechtfertigungslehre eine Ursache für die Thesen gewesen sein.
Weitere Ursachen waren die 1515 verabschiedete Ablassbulle des Papstes, die Einführung der Plenarablässe und die Konkurrenz zu Johann Tetzel. Alle diese Ursachen werden im Folgenden einzeln beschrieben.
Moralphilosophie und Rechtfertigungslehre
Luther war Mönch im Augustinerorden. Und dieser Orden war einer der vier großen Bettelorden des Mittelalters. Gepredigt wurde Armut und Besitzlosigkeit als christliches Ideal. Dass sich die Kirche vorsätzlich an den Sündern bereichern würde, war für Luther ebenfalls eine Sünde.
Außerdem studierte Luther die Bibel. Dort fand er nichts Konkretes, wie die Gnade Gottes zustande kommt oder wem diese zuteilwird. Daraufhin formulierte er seine eigene Rechtfertigungslehre (sola gratia, lateinisch: allein durch die Gnade), wonach das Gottesgnadentum weder willkürlich noch beschreibbar wäre. Doch Eines war Luther klar: Niemand konnte Punkte sammeln, um sich einen Platz im Jenseits zu ergattern.
Die 95 Thesen waren demnach eine Kirchenkritik und hatten den Anschein, dass Luther den armen Menschen zur Seite stehen wollte. Aber tatsächlich war es eine Kritik an der Kirche, das Gottesgnadentum falsch verstanden zu haben bzw. falsch auszulegen. Die 95 Thesen waren demnach ein Streit über den Inhalt bzw. die Auslegung der Bibel.
Luthers Rechtfertigungslehre entstand wohlmöglich bereits 1511 in seinem Arbeitszimmer im Südturm des Wittenberger Augustinerklosters. Im Römerbrief des Paulus stolperte Luther über eine Textstelle:
„Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus dem Glauben leben.“
Luther folgerte daraus, dass die Gerechtigkeit Gottes ein reines Gottesgeschenk sei. Jenes Gnadengeschenk wird jedem Gläubigen geschenkt, welcher sich zu Jesus Christus als seinen Erlöser bekennt. Und keinerlei Eigenleistung könne dieses Geschenk erzwingen.
Die Formulierung der 95 Thesen basieren genau auf dieser Schlussfolgerung (Luthers Turmerlebnis). Aber als Forderung wurden die Thesen erst 1517 formuliert, nachdem der Papst eine neue Ablassbulle erließ.
Ablassbulle des Papstes von 1515
Am 31. März 1515 erließ Papst Leo X. eine Ablassbulle. Das dadurch eingenommene Geld sollte den Neubau des Petersdoms finanzieren. Außerdem sollten die Schulden des Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, welche dieser bei den Fuggern hatte, zurückbezahlt werden.
Plenarblass
Das wirklich lukrative an der neuen Ablassbulle war die Beschließung eines Plenarablasses. Solch ein Plenarablass war so etwas wie eine Flatrate auf Sünden. Der Sünder konnte sich durch den Kauf eines solchen Ablassbriefes von fast alle Sünden befreien.
Die Ablassbriefe sollten für 8 Jahre in Magdeburg, Mainz und Brandenburg vertrieben werden.
Wittenberger Pilgertum
Die Stadt Wittenberg gehörte damals zum Kurfürstentum Sachsen. Und der dort regierende Kurfürst war Friedrich der Weise von Sachsen. Er war entschieden gegen den Handel von Plenarablässen. Denn in Wittenberg befand sich eine Reliquiensammlung, wodurch die Stadt zu einer Pilgerstätte wurde.
Im Mittelalter pilgerten Christen zu solchen Stätten, um Buße und Vergebung zu erlangen. Somit stand der Ablasshandel in direkter Konkurrenz zum Pilger-Tourismus in Wittenberg. Für Luther bedeutete dies ganz konkret, dass die Wittenberger der Beichte fernblieben. Stattdessen fuhren sie nach Zerbst oder Jüterbog und kauften dort Ablassbriefe.
Tetzels Ablassanweisung
Ein findiger Händler mit Plenarablässen war der Dominikaner Friedrich Tetzel. Er formulierte die Werbebotschaft: “
„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt“
Mit solchen Botschaften sollte der Ablasshandel richtig vorangetrieben werden. Um den finanziellen Erfolg des Ablasshandels zu erhöhen, ließ Tetzel eine Ablassanweisung drucken. Mit dieser Anweisung verdiente Tetzel monatlich 80 Gulden.
Im Kurfürstentum Sachsen, also auch in Wittenberg, konnte man keinen Plenarablass erwerben, da der Kurfürst den Handel verboten hatte. Aber viele Sachsen reisten nach Zerbst oder Jüterbog, um dort die begehrten Ablassbriefe zu bekommen. Und so bekam Luther im Spätsommer die Ablassanweisung von Tetzel zu lesen und war innerlich aufgebracht.
Luther entwickelte in der Folge einen innerlichen Konflikt zu kirchlichen Autoritäten. Es folgte im September ein erster Thesenentwurf. Diese Liste bestand aus insgesamt 97 Thesen, welche Luther vor seinen Wittenberger Studenten ausdiskutierte.
Am 31. Oktober 1517 schrieb Luther einen Brief an den Erzbischof von Mainz (Albrecht von Brandenburg). In diesem Brief formulierte Luther seine Sorgen über Missverständnisse, welche der Handel mit Plenarablässen in der Bevölkerung auslösen würde. Dem Brief legte er seine endgültigen 95 Thesen bei.
Wo hat Martin Luther die 95 Thesen angeschlagen
(siehe auch Hauptartikel: Fragen und Antworten zum Thesenanschlag Luthers)
Laut Legende soll Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg geschlagen haben. In der Schlosskirche befand sich die Reliquiensammlung, welche Friedrich der Weise mühselig angelegt hatte. Dadurch war die Kirche zum Wallfahrtsort geworden.
Laut Legende soll Luther die Thesen an die Kirchentür genagelt haben, um zu einer Diskussion über den Ablasshandel anzuregen. Ob der Thesenanschlag tatsächlich stattfand oder nicht, gilt als umstritten.
Die Erzählung vom Thesenanschlag wurde von Philipp Melanchthon verbreitet. Lange galt der Thesenanschlag als ahistorische Legende. Doch eine Notiz von Georg Rörer, welcher mit Luther, Melanchthon und Johannes Bugenhagen in Wittenberg lebte, bekräftigt die Anschlagserzählung.
Andere Forscher sind der Meinung, dass Luther seine 95 Thesen an seine Studenten und Kollegen verschickt habe. Dadurch kursierten die Ablassthesen bereits in Wittenberg, bevor der eigentliche Thesenanschlag erfolgte. Die Ablassdiskussion fand demnach schon viel früher als das eigentliche Anschlagsereignis statt.
Wie wurden die 95 tatsächlich veröffentlicht
Nachweislich wurden die 95 Thesen dem Brief beigelegt, welchen Martin Luther am 31. Oktober 1517 an den Erzbischof von Mainz schrieb. Der Erzbischof war Vorgesetzter von Johann Tetzel und Luther beschwerte sich über die Ablassanweisungen des Predigers.
Im Brief erwähnt Luther, dass Albrecht von Brandenburg wahrscheinlich gar nichts von den Ablassinstruktionen seines Predigers wisse. Und deshalb wolle Luther ihn darauf hinweisen. Dass der Papst höchstpersönlich die Ablassbulle verabschiedet hatte, lässt Luther aus. Luther unterschrieb den Brief als Doktor der Theologie und legte seine 95 Thesen bei.
Mit weiteren Briefen wandte sich Luther an die Bischöfe von Magdeburg und Brandenburg. Denn auch dort wurde der Plenarablass vertrieben. Weitere Briefe erhielten verschiedene Gelehrte, da Luther sich ein Feedback und eine Diskussion erhoffte.
In welcher Sprache waren die 95 Thesen ursprünglich verfasst
Die 95 Thesen wurden in lateinischer Sprache geschrieben. Denn im Mittelalter war Kirchenlatein die gängige Sprache der Theologen und geistlichen Gelehrten. Und für genau diese Zielgruppe waren die 95 Thesen ursprünglich bestimmt gewesen.
Was wollte Luther mit den 95 Thesen erreichen
Luther wollte höchstwahrscheinlich keine Veränderung in der Kirchenstruktur anstoßen. Stattdessen waren die 95 Thesen zunächst nur dafür gedacht gewesen, eine theologisch-akademische Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Ablasshandels anzuregen. Deshalb verschickte Luther seine Briefe nicht nur an Bischöfe, sondern auch an namhafte Kirchengelehrten.
Dass die Ablassthesen innerhalb der theologisch-akademischen Gemeinde solch einen Widerhall fanden, bezeichnete Luther selbst als Wunder.
Wie reagierten Papst und Kirche auf die 95 Thesen
Die Erfindung des Buchdrucks sorgte dafür, dass Luthers Thesen sehr günstig und sehr schnell vervielfältig werden konnten. Dadurch wurden die Thesen irgendwann zum Problem für Papst und Kirche.
Ein Gutachten, welches von der Universität in Mainz gefertigt wurde, empfahl – dass die Thesen von der Römischen Kurie geprüft werden sollten. Jene Kurie ist die Gesamtheit aller Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls. Und eine Prüfung vor dieser Kurie sollte feststellen, ob der Handel mit Plenarablässen kirchenjuristisch standhielt.
Ablassdiskussion mit Tetzel
Natürlich erreichten die Ablassthesen auch Johann Tetzel, welcher diese nicht juristisch sondern akademisch kritisierte. So bezeichnete Tetzel die Ablassthesen als Irrtümer und bekräftigte, dass die Ablasspraxis als ein Teil der Buße interpretiert werden könne.
Da die ganze Ablassdiskussion mit Tetzel höchst akademisch war, verfasste Luther im März 1518 eine Schrift, welche so geschrieben war – dass sie jeder verstand. Veröffentlicht wurde diese unter dem Titel: „Sermon von dem Ablass und Gnade“.
In jener Schrift bezeichnet Luther den Ablass als eine Praxis für faule Christen. Diese Schrift wurde der erste große literarische Erfolg Luthers.
Vorwurf der Ketzerei
Im März 1518 beauftrage Papst Leo X. einen Hoftheologen, namens Silvester Mazzolini, damit – die Lutherthesen zu prüfen. Viele sächsische Dominikaner bezeichneten Luther bereits als Ketzer. Und auch Mazzolini kam zu dem Entschluss, dass Luther ketzerisch handele. Denn indem man sagt, dass die römische Kirche nicht das tun darf – was sie tut – macht man sich der Ketzerei schuldig – so Mazzolini.
Weitere Gelehrte kamen zu einem ähnlichem Schluss. Und deshalb eröffnete die römische Kurie im Juli 1518 ein Verfahren gegen Luther, welches ihn wegen Ketzerei anklagte.
Reichsbann
Luthers Fürsprecher war Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, welcher wirtschaftliche Interessen daran hatte – dass der Plenarablass aus dem Verkehr genommen wurde.
Und da Friedrich ein Kurfürst war, war er stimmberechtigt bei der Wahl des deutschen Königs. Und dieser Königstitel war im Mittelalter eine Vorstufe zum römischen-deutschen Kaiser. Demnach besaß der Kurfürst politische Macht, welche er für Luther einsetzte. Und so bewirkte Friedrich der Weise, dass Luther vor dem Reichstag in Worms vorsprechen konnte.
Der Reichstag fand 1521 statt und Luther sollte seine Ablassthesen widerrufen. Er tat es nicht, weshalb der Reichsbann über ihn verhängt wurde.
Aber Friedrich der Weise und Kaiser Karl V. hatten im Vorfeld vereinbart, dass der Reichsbann nicht für das Kurfürstentum Sachsen gelte. Demnach konnte Luther nach Sachsen fliehen und kam auf der Wartburg bei Eisenach unter. Dort übersetzte er zwischen 1521 und 1522 das Neue Testament der Bibel ins Deutsche. Fortan konnte auch der einfache Mann das Wort Gottes nachlesen und brauchte nicht darauf hoffen, dass irgendein Priester es falsch deutete.
Welche Folgen hatte die Veröffentlichung der 95 Thesen
Die Veröffentlichung von Luthers Thesen war – neben der Entdeckung Amerikas, der Erfindung des Buchdrucks und dem Finden des Seeweg nach Indien – das bedeutendste Ereignis der Frühen Neuzeit. Denn genau wie die genannten Ereignisse hatten auch Luthers Ablassthesen eine enorme Langzeitwirkung.
Gesellschaftsreform
Als Luther die Thesen verfasste, waren diese als Diskussionsgrundlage für fachkundige Theologen gedacht. Aber schnell verselbständigte sich die Ablassdiskussion und wurde zur gesellschaftskritischen Debatte. Denn viel zu lange existierte eine Kirchenverfassung, welche von vielen zwar akzeptiert, aber nur stillschweigend hingenommen wurde.
So wurde schon lange auf Reichstagen des Heiligen Römischen Reiches die päpstliche Finanzwirtschaft missbilligt. Aber bislang konnten Papst und Klerus jegliche Kritik mit Gotteswillen abschmettern. Doch nun war einer der Ihren auf die Idee gekommen, das System von innen zu hinterfragen. Und dieses Hinterfragen führte dazu, dass die päpstliche Finanzwirtschaft als Missbrauchssystem entlarvt wurde.
Zwar wollte Luther eigentlich nur eine Ablassdiskussion anstoßen, aber anstelle der erhofften Diskussion folgten 1518 der Ketzerei-Vorwurf und schließlich der Kirchenbann. Denn die Thesen kritisierten offensichtlich herrschende Missstände, welche auf Grundlage der Bibel entworfen wurden.
Da in der Bibel nichts zum römisch-katholischen Ablasskonzept steht, waren die Thesen zu keiner Zeit eine Bibelkritik oder Glaubenskritik. Stattdessen wurden sie aber zu einer Kritik an der Kirche als Institution.
Religionskriege
Jene Kirchenkritik mündete in verschiedene Religionskriege, welche mit der Reformation begannen. Denn einige Herrscher sahen in der Reformation eine Chance, sich der Einflussnahme von Papst und Kirchenstaat zu entziehen.
Innerhalb der Westkirche sollte die Gegenreformation abtrünnige Gebiete wieder katholisch machen. Aus den Konfessionskonflikten wurden Religionskriege, wie der Schmalkaldische Krieg (1546 – 1547), die Hugenottenkriege (1562 – 1598) und der Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648).
Kirchenspaltung in Konfessionen
Luthers Kirchenkritik richtete sich irgendwann direkt gegen das Papsttum als geistliche Institution. Dies wirkte nach und sorgte dafür, dass sich die Westkirche des Abendlandes für immer spalten sollte: katholisch vs. protestantisch bzw. evangelisch.